Prozessfetisch
Wenn jemand in fünf Minuten den Konsensprozess erklären müsste, so könnte sie damit beginnen, kurz die Art der Diskussion zu beschreiben, die einer Entscheidung durch die Gruppe vorangehen sollte. Eine solche Beschreibung würde wohl recht vage bleiben: Es würde um Dinge gehen wie das Zuhören, die Einbeziehung aller Sichtweisen, kritische Diskussion und Argumentation sowie Kreativität in der Formulierung möglicher Kompromisse und Synthesen. Man würde aber wohl bald das Thema wechseln, von der Diskussion weg hin zum konkreten Vorgehen, das zur formalen Entscheidungsfindung benutzt wird. Dessen Darstellung ist ganz und gar nicht vage, sondern so präzise formulierbar wie jede Wahlprozedur. Man würde erklären, wie ein Antrag vorgeschlagen wird, wie Leute die Möglichkeit haben, sich für Unterstützung, Zurückhaltung oder Blockade zu entscheiden, dass ein Antrag nur von der Gruppe beschlossen werden kann, wenn niemand ihn blockiert usw. (Wahrscheinlich – und das ist ein wichtiger Punkt – haben die meisten, die schon einmal an Entscheidungen unter dem Banner des Konsensprozesses teilhatten, nicht viel mehr als ein solch fünfminütiges Verständnis der Vorgänge.)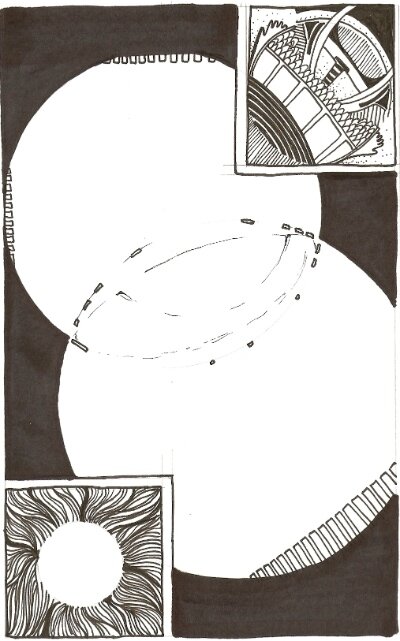
Wenn man deutlich mehr als nur fünf Minuten Zeit hätte, den Konsensprozess zu erklären, dann würde man wohl wenig mehr über das formale Vorgehen der Entscheidungsfindung sagen. Dieser Teil kann wirklich in wenigen Minuten definiert werden. Man würde vielmehr detaillierter auf das komplexe, ungewissere, stark kontextorientierte Vorgehen eingehen, das dem eigentlichen Fällen einer Entscheidung vorangeht. Man würde sich also auf den Prozess der Diskussion, der Formulierung von Optionen und Argumenten usw. konzentrieren.
Im Folgenden bezeichne „Praxis“ den komplexen Prozess der Diskussion – einen Prozess, über den viel gesagt werden kann, aber dessen korrektes Funktionieren wohl kaum über einen Satz genauer Regeln definiert werden kann. Auf den Satz formaler Regeln, die eine Methode der Entscheidungsfindung beschreiben, wird sich der Begriff „Prozedur“ beziehen. Diese Unterscheidung ist für sich genommen weder überraschend noch neu, ich möchte aber behaupten, dass sie von großer Bedeutung für die Debatte über Mehrheitswahl und Konsens ist. Solche Debatten stehen im Zentrum anarchistischer Theorie, da sie die Form und den Inhalt demokratischer Einbeziehung betreffen. Mehr noch, wenn etwas essentiell für den Anarchismus ist, dann ist es die Idee, dass soziale Entscheidungen von allen Betroffenen zu treffen sind, und dass diese Einbeziehung grundsätzliche Teilhabe einer jeden Person an Erwägung ebenso wie an Entscheidung beinhalten muss. Daher ist eine Auseinandersetzung über die Natur dieser Teilhabe eine Auseinandersetzung über den Kern des Anarchismus.
Ich behaupte aber, dass die Diskussion über Wahl und Konsens äußerst fehlerhaft verläuft. Erstens werfen viele Vertreter beider Seiten auf schädliche Weise Prozedur und Praxis in einen Topf – sie kritisieren die Prozeduren der jeweils anderen Seite, verteidigen aber nicht ihre eigenen Prozeduren, sondern vielmehr ihre Auffassung der Praxis. Zweitens stellt sich heraus, dass die Antwort auf die Frage, wie wir uns sinnvollerweise organisieren sollten – orientiert an einer Konsensregel oder an Mehrheitsentscheiden – entscheidend davon abhängt, ob wir über Prozedur oder Praxis sprechen. Kurz, und vielleicht etwas in die Irre führend: Prozeduren sollten eher in Richtung Mehrheitsentscheid gehen, aber nur im Dienste einer Praxis, die von einem deutlichen Bekenntnis zum Konsens geprägt ist. In meiner Argumentation für diesen zweiten Punkt werde ich zeigen, dass die Konsensprozedur gänzlich ungeeignet ist für radikale Organisationen. Gleichzeitig stelle ich die These auf, dass ein einseitiger Fokus auf Prozeduren letzlich das wirkliche Problem ist. Das führt uns zum dritten und wichtigsten Punkt. Eine antiautoritäre, demokratische Organisation darf sich nicht als über eine Reihe formaler Prozeduren definiert verstehen. Regeln können als Werkzeuge einer tugendhaften Gemeinschaft mit weitgehend funktionierender Praxis verwendet werden, sie sollten aber nie mehr als Werkzeuge sein.
Das Ziel einer demokratischen Gemeinschaft als Suche nach dem richtigen Satz formaler Regeln zu verstehen, die dann blind befolgt werden können, ohne dass es nötig ist, über ihre gute und gerechte Anwendung zu wachen, ist keinen Deut besser als die Suche nach dem besten und gerechtesten König zum Ziel zu erklären. Aus einem Prozess einen Fetisch zu machen – eine Art, etwas zu tun, zu verehren – kann ebenso unterdrückend sein, wie einen Fetisch aus persönlicher Autorität zu machen.
§1 Mehr Hitze als Licht
Man könnte erwarten, dass Diskussionen über Entscheidungsfindungsprozesse bei Anarchisten zu den intellektuell differenziertesten, höflichsten und gemeinschaftlichsten Debatten der politischen Philosophie zählen. Schließlich ist die Idee, dass Menschen ohne autoritäre oder hierarchische Aufsicht gerechte Entscheidungen auf eine Weise treffen können, die die Autonomie des Individuums sowohl ausdrückt als auch fördert, zentral für den Anarchismus. Darum streben Anarchisten zumindest in ihren internen Diskussionen darüber, wie diese Ziele in existierenden Organisationen erreicht werden können, danach, die kollaborativen Prozesse anzuwenden, die sie auch für die Gesellschaft als Ganzes propagieren.
Andererseits gibt es da noch die reale Welt.
Obwohl sorgfältige und respektvolle Beiträge zur anarchistischen Debatte über Gruppenprozesse existieren, findet man weitaus mehr Verzerrung, Anklage, und Auf-den-Tisch-Hauen. Beispielsweise versuchen Befürworter des Konsenses, Wahlen mit Einschüchterung, gedankenlosen Mechanismen, gedanklicher Unnachgiebigkeit und der Anerkennung der repräsentativen Demokratie in Verbindung zu bringen.
Konsens heißt, Entscheidungen im gemeinsamen Einverständnis aller zu treffen. Er ist frei von Zwang, da er es vermeidet, anderen jemandes Willen aufzuzwingen. […] Konsens ist tatsächlich natürlicher als Mehrheitswahl. […] Beim Konsens ermutigt die Gruppe das Mitteilen aller Sichtweisen der am Thema Interessierten. Diese Sichtweisen werden dann in einer Atmosphäre des Respekts und des gegenseitigen Aufeinanderzugehens diskutiert. Neue Ideen erwachsen und Sichtweisen werden synthetisiert, bis ein Ausdruck gefunden ist, der allgemeine Zustimmung genießt. […] Konsens ist "organisch" – im Gegensatz zum mechanischen Wählen. [Mark Shepard]1
Konsens ist ein Entscheidungsfindungsprozess, der sich dem Recht jeder Person verschrieben hat, Entscheidungen zu beeinflussen, von denen sie betroffen ist. […] Konsens ist ein kreativer Prozess. Er dient der Synthese der Ideen und Bedenken aller Gruppenmitglieder. Im Gegensatz zu einer Wahl ist er keine Gewinn-oder-Verlust-Methode, er ist nicht gegensätzlich. Beim Konsens müssen wir nicht zwischen zwei Alternativen wählen. Stattdessen können wir eine dritte, eine vierte oder mehr erschaffen, da wir anerkennen, dass Probleme viele mögliche Lösungen haben können. Jene, die von unseren verschiedene Vorstellungen haben, werden nicht zu unseren Gegnern; stattdessen können ihre Ansichten uns als frische und wertvolle neue Perspektive dienen. Indem wir daran arbeiten, ihre Bedenken einzuflechten, stärken wir möglicherweise unsere Vorschläge. Verwenden wir Konsens, dann ermutigen wir die aktive Beteiligung jeder Person, und wir hören jeder Person aufmerksam zu. [Sanderson Beck]2
Oder schließlich:
Eine Wahl ist ein Prozess, in dem Menschen ihre Präferenzen ausdrücken – ob nun tiefempfunden oder nur schwach ausgeprägt. Wähler sind gewöhnlich gezwungen, zwischen zwei Vorschlägen zu wählen – vorgeblich gegensätzlich, aber meist beide inakzeptabel: „Würdest du lieber mit einem Stock ins Auge gepiekst, oder mit einem Stein auf den Kopf geschlagen werden?“ Die Entscheidung wird nur durch einfaches Zusammenzählen dieser Präferenzen erreicht. Wahlen verlocken häufig zu gerissenen Manipulationen. [Randy Schutt]3
„Jene, die andere Vorstellungen als wir haben, werden nicht zu unseren Gegnern; stattdessen können ihre Ansichten uns als frische und wertvolle neue Perspektive dienen,“ … es sei denn, sie befürworten Wahlen! Wenn sie Wahlen gutheißen, so scheint es, gibt es kaum Grenzen für die Verzerrungen und Ablenkungsmanöver, die wir verwenden können. Warum können wir, wenn wir Wahlen befürworten, nicht respektvoll mit anderen Ansichten umgehen und aus ihnen lernen? Warum dürfen wir nur zwei Vorschläge berücksichtigen? Warum müssen wir Menschen einschüchtern, oder ihr Recht ignorieren, auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen, die sie betreffen?
Wer den gegenwärtigen Trend zum Konsens in anarchistischen Kreisen kritisiert, ist häufig noch schlimmer:
Die einzige kollektive Alternative zur Mehrheitswahl als Mittel zur Entscheidungsfindung, die üblicherweise vorgestellt wird, ist die Praxis des Konsens. Der Konsens wurde von bekennenden „Anarcho-Primitivisten“ mystifiziert, die Eiszeitmenschen oder auch gegenwärtige „primitive“ oder „ursprüngliche“ Völker als Höhepunkt der sozialen und psychischen Errungenschaften der Menschheit ansehen. Ich bestreite nicht, dass Konsens eine angemessene Form der Entscheidungsfindung für kleine Gruppen ist, deren Mitglieder sich sehr gut kennen. Doch was Konsens in der Praxis angeht, so hat meine eigene Erfahrung mir gezeigt, dass wenn größere Gruppen versuchen, Entscheidungen per Konsens zu treffen, sie in der Regel gezwungen sind, sich für ihre Entscheidung beim kleinsten gemeinsamen intellektuellen Nenner zu treffen: Die am wenigsten umstrittene oder gar mittelmäßigste Entscheidung, die eine größere Versammlung von Menschen erreichen kann, wird übernommen – eben weil alle dem Beschluss zustimmen oder sich enthalten müssen. Noch verstörender ist, dass ich erfahren musste, dass Konsens sogar hinterlistigen Autoritarismus und grobe Manipulationen erlaubt – selbst wenn er im Namen von Autonomie oder Freiheit angewandt wird.
Ich kann persönlich bezeugen, dass innerhalb der Clamshell Alliance [eine Anti-Kernkraft-Organisation in Neu-England, A.d.Ü] Konsens gefordert wurde von häufig zynischen Quäkern und von Mitglieder einer dubiosen „anarchischen“ Kommune aus Montague, Massachusetts. […] Um Konsens bei einer Entscheidung zu erzwingen, übte diese Clique oft subtilen Druck oder psychischen Zwang aus. Minderheiten mit anderer Meinung wurden dazu gebracht, sich aus schwierigen Themen herauszuhalten, indem ihnen klargemacht wurde, dass ihr Dissens sich als Ein-Personen-Veto auswirken würde. […] Indem die Betroffenen sich zurückzogen, hörten sie auf, politische Wesen zu sein – damit eine „Entscheidung“ gefällt werden konnte. […] Auf einer theoretischeren Ebene ließ der Konsens den wohl wichtigsten Teil jedes Dialogs verstummen: Dissens. Der anhaltende Dissens, der leidenschaftliche Dialog, der selbst dann verbleibt, wenn eine Minderheit sich zeitweise einem Mehrheitsentscheid fügt, wurde in der Clamshell durch langweilige Monologe ersetzt – und durch die unumstrittene und abtötende Monotonie des Konsenses. Bei Mehrheitsentscheiden kann die besiegte Minderheit darauf zurückkommen, eine Entscheidung rückgängig zu machen, in der sie besiegt wurde – sie ist frei, ihren Widerspruch offen und kontinuierlich mit rationalen und potentiell überzeugenden Argumenten zu artikulieren. Konsens hingegen respektiert Minderheiten nicht, er lässt sie verstummen zugunsten eines metaphysischen „wir“ der „Konsens“-Gruppe.
Die kreative Rolle des Dissens, wertvoll als andauerndes demokratisches Phänomen, neigt dazu in der grauen Uniformität zu verblassen, die der Konsens benötigt. Jede libertäre Ideensammlung, die Hierarchie, Klassen, Dominanz und Ausbeutung zu überwinden versucht, indem sie auch nur Marshalls „Ein-Personen-Minderheit“ erlaubt, Entscheidungen einer Mehrheit einer Gesellschaft zu blockieren, sogar in regionalen und landesweiten Föderationen, würde zu einem Rousseau'schen "allgemeinen Willen" mutieren, mit einer alptraumhaften Welt der intellektuellen und psychischen Gleichheit. [Murray Bookchin]4
Fühlen wir uns nicht alle ermutigt, Murrays Position zu widersprechen?
Dissens muss darum gefördert werden, nicht behindert. Nur durch eine prinzipientreue Diskussion über das, was bei einem Thema auf dem Spiel steht, kann die Wahrheit geklärt werden. Es sind Liberale – jene, die das System akzeptieren –, die Wahrheiten zu Platitüden verwässern und verschleiern, denen jeder zustimmen kann, und die Konsens in der Form von „Frieden“ suchen. In einer Zeit der Anpassung wie der unseren – wie zu allen Zeiten – sind es Liberale, die die Wichtigkeit klärender radikaler Wahrheiten leugnen.
Mehrheitsregelungen sind die demokratische Methode den Willen einer großen Gruppe bei der Entscheidungsfindung zu bestimmen. Denn Mehrheitsrecht schützt das Recht der Minderheiten, anderer Meinung zu sein, es befreit sie von der Verpflichtung, eine Gruppenentscheidung mitzutragen, der sie eigentlich widersprechen. Um Meinungsvielfalt wertzuschätzen muss daher Mehrheitsrecht in großen Gruppen als akzeptabler Prozess angesehen werden. [Janet Biehl]5
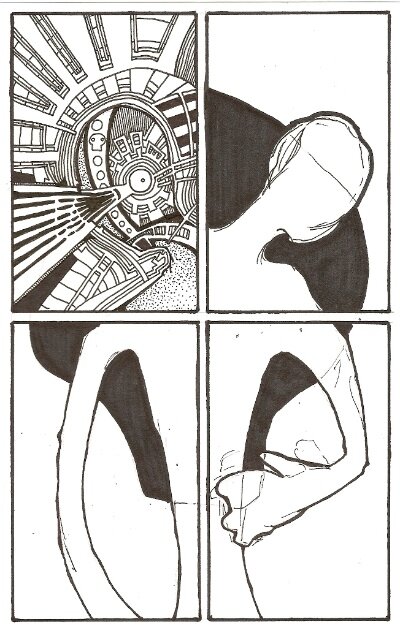 Es zeugt meiner Meinung nach von der Emotionalität der Debatte, dass diese ernstzunehmenden Denker und Aktivisten sich in so atemberaubend irrationale Aneinanderreihungen von Verzerrungen verstricken. Zunächst möchte ich mich auf einen Aspekt der Verzerrung konzentrieren: Jede Seite charakterisiert die jeweils andere als Verteidigerin einer formalen Prozedur, an die dann ein sehr hoher Anspruch gestellt wird: im Grunde, narrensicher zu sein. Das heißt, wenn im Rahmen der Prozedur Verhalten denkbar ist oder stattgefunden hat, das unsere Kernwerte verletzt oder zu einer Diskussionskultur führt, die wir nicht gutheißen, dann ist das Grund genug, die Prozedur abzulehnen. Auf der anderen Seite definiert sich jede Seite nicht allein über ihre formale Prozedur, sondern immer in Verbindung mit einer vagen Andeutung ihrer guten Praxis, ihrer gerechten Institutionen und ihrer tugendhaften Akteure.
Es zeugt meiner Meinung nach von der Emotionalität der Debatte, dass diese ernstzunehmenden Denker und Aktivisten sich in so atemberaubend irrationale Aneinanderreihungen von Verzerrungen verstricken. Zunächst möchte ich mich auf einen Aspekt der Verzerrung konzentrieren: Jede Seite charakterisiert die jeweils andere als Verteidigerin einer formalen Prozedur, an die dann ein sehr hoher Anspruch gestellt wird: im Grunde, narrensicher zu sein. Das heißt, wenn im Rahmen der Prozedur Verhalten denkbar ist oder stattgefunden hat, das unsere Kernwerte verletzt oder zu einer Diskussionskultur führt, die wir nicht gutheißen, dann ist das Grund genug, die Prozedur abzulehnen. Auf der anderen Seite definiert sich jede Seite nicht allein über ihre formale Prozedur, sondern immer in Verbindung mit einer vagen Andeutung ihrer guten Praxis, ihrer gerechten Institutionen und ihrer tugendhaften Akteure.
Bookchin und Biehl beispielsweise definieren Konsens als die Prozedur mit der Entscheidungen nur angenommen werden, wenn sie allgemeine Zustimmung genießen (möglicherweise mit Enthaltungen) und eine einzelne Person jegliches Handeln blockieren kann. Daraufhin präsentiert uns Bookchin ein Beispiel einer Gruppe – der Clamshell Alliance –, die diese Prozedur missbrauchte und Druck auf andere ausübte, dem Konsens zuzustimmen.6 (Es ist hier wohl kaum nötig, seinen durchsichtigen Trick der Sippenhaftnahme durch die Erwähnung der Primitivisten anzusprechen.) Biehl und Bookchin schließen beide aus Beispielen wie diesem darauf, dass Konsens grundsätzlich die Existenz von Minderheiten leugne, sie zur Konformität dränge, radikale Wahrheiten verwässere und sogar zu einer „alptraumhaften Welt der intellektuellen und psychischen Konformität“ führe.7
Ganz ähnlich definieren viele Verfechter des Konsenses „Mehrheitsrecht“ als Prozedur der Wahl zwischen zwei vorausgewählten Möglichkeiten. Sie nehmen an, Menschen entschieden sich für und wählten ihrer vorigen Neigung gemäß („ob nun tiefempfunden oder nur schwach ausgeprägt“); solche Entscheidungen würden nicht „in einer Atmosphäre des Respekts und des gegenseitigen Aufeinanderzugehens diskutiert“; es gebe kein Bemühen um Neuformulierung der Optionen oder um das Finden neuer Optionen; jene mit anderen Ansichten würden als „Gegner“ angesehen; Manipulation trete häufig auf.
Es wird also in beiden Fällen die Praxis konkreter, keineswegs idealer Gruppen kritisiert, die die jeweils abgelehnte Prozedur verwenden. Es gibt sicherlich keinen fundamentalen Grund, warum die Unterscheidung ablehnender Voten in Blockade und Tolerierung notwendig zu einer Unterdrückung von Dissens führt. Tatsächlich verschafft Konsens logischerweise Minderheiten größere, sogar diktatorische Macht. Allein dadurch, dass gewählt wird, ist offenbar nicht garantiert, dass eine böswillige Mehrheit nicht versuchen wird Minderheiten zur Zustimmung zu drängen, da einstimmige Entscheide Stärke, Solidarität usw. zeigen. Es ist also wirklich ganz offensichtlich, dass die Sorgen Bookchins und Biehls nichts mit der Auswahl der Prozedur, die man anwendet, zu tun haben.
Genausowenig jedoch gibt es einen Grund, warum der Einsatz des Mehrheitsrechts einen Mangel an Diskussion, die Begrenzung der Optionen auf zwei, oder die Behandlung von Mitmenschen als Gegner voraussetzt. Eine Gruppe kann jede Art von gleichberechtigter, integrierender, ergebnisoffener Diskussion führen, die sie mag, dabei Positionen neu formulieren, Optionen auf Einstimmigkeit austesten, vom Dissens lernen, usw. - und trotzdem am Ende bei einer Mehrheitswahl über den Vorschlag angelangen, der die meiste Unterstützung in der Diskussion zu haben scheint. Daher konzentrieren sich die oben zitierten Verfechter des Konsens nicht mehr auf die zentralen Eigenschaften von Gruppen, die Wahlen verwenden, als Bookchin und Biehl dies bei Konsensgruppen tun.
Wenn es einen diskussionswürdigen Punkt in der Argumentation beider Seiten gibt, dann kann es nur der sein, dass das schädliche Verhalten, das sie beklagen, bei der jeweils angegriffenen Position wahrscheinlicher auftritt. Keine der Seiten aber – ebensowenig andere Literatur, die mir bekannt ist – versucht ernsthaft zu argumentieren, dass die eine Prozedur wahrscheinlicher auf diese Weise missbraucht wird als die andere. Vermutlich würde eine solche Behauptung konkrete statistische Belege benötigen. Ich bin skeptisch, dass solche Verallgemeinerungen in absehbarer Zeit vorliegen werden. In meiner eigenen recht umfangreichen Erfahrung mit Aktivistengruppen habe ich beide Prozeduren gut angewandt, aber auch missbraucht erlebt, beide etwa gleich häufig.
Man vergleiche, wie im Gegensatz dazu jede Gruppe ihren eigenen Ansatz diskutiert: „Beim Konsens ermutigt die Gruppe das Mitteilen aller Sichtweisen aller am Thema Interessierten. Diese Sichtweisen werden dann in einer Atmosphäre des Respekts und des gegenseitigen Aufeinanderzugehens diskutiert. Neue Ideen erwachsen und Sichtweisen werden synthetisiert bis ein Ausdruck gefunden ist, der allgemeine Zustimmung genießt.“ Oder eine ausführlichere Stellungnahme:
Wie würde ein alternativer revolutionärer Entscheidungsprozess aussehen, fragst du? Zunächst ein grundsätzlicher Wechsel von Konkurrenz hin zu Kooperation. […] Kooperation ist mehr als „leben und leben lassen“. Es ist das Bemühen, die Sichtweise anderer zu verstehen. Andere Perspektiven werden der eigenen hinzugefügt, sodass eine neue entsteht. Man setzt seinen Zweifel aus, wenn auch nur temporär, damit man einen Blick für den Glanz der Wahrheit anderer Ideen bekommt. Es ist ein Prozess der Kreativität, Synthese und Offenheit, der zu Vertrauensbildung, besserer Kommunikation und besserem Verständnis und schließlich zu einer stärkeren, gesünderen und erfolgreicheren Gruppe führt. […] Der letzte und sichtbarste Schritt hin zu revolutionärem Wandel im Gruppenprozess ist die Art, wie Gruppenmitglieder miteinander umgehen. Dominanzbestrebungen und Kontrollverhalten werden nicht toleriert. Menschen begegnen sich respektvoll und erwarten, Respekt zu erhalten. Jede tut ihr persönlich Bestes, der Gruppe beim Fällen von Entscheidungen, die im besten Interesse der Gruppe sind, zu helfen. Es gibt keine Positionierung und kein Parteiergreifen. Konflikte werden als Gelegenheit für Wachstum, für die Erweiterung des Denkens, für den Austausch neuer Informationen und für die Entwicklung neuer Lösungen gesehen, die die Perspektiven aller einbeziehen. Die Gruppe erzeugt eine Umgebung, in der jeder ermutigt wird teilzunehmen, in der Konflikte frei ausgedrückt werden und Beschlüsse im besten Interesse aller Beteiligten sind. [C.T. Lawrence Butler]8
Es ist interessant, dass Befürworter von Wahlen ähnliche Praxen unterstützen, wenn man sie selbst sprechen lässt. Nochmals Bookchin:
Selbst ein so sachkundiger Historiker des Anarchismus wie Peter Marshall stellt fest, dass für Anarchisten „die Mehrheit kein größeres Recht hat, der Minderheit zu diktieren, selbst einer einzelnen Person, als die Minderheit der Mehrheit.“ Zahllose Libertäre haben diese Idee seitdem wiedergegeben.
Auffallend an Äußerungen wie dieser ist ihre hochgradig schlechtmachende Sprache. Mehrheiten, so scheint es, „entscheiden“ oder „debattieren“ nicht: vielmehr „regieren“, „diktieren“, „befehligen“, „erzwingen“ sie oder ähnliches. In einer freien Gesellschaft, die Dissens nicht nur erlauben, sondern in höchstem Maße fördern würde, deren Podien bei Versammlungen und deren Medien offen wären für den vollständigen Ausdruck aller Sichtweisen, deren Institutionen wirkliche Foren der Diskussion wären – man mag berechtigterweise fragen, ob solch eine Gesellschaft wirklich irgendjemandem etwas „aufzwingen“ würde, wenn sie zu einer Entscheidung gelangen müsste, die das Allgemeinwohl betrifft. 4
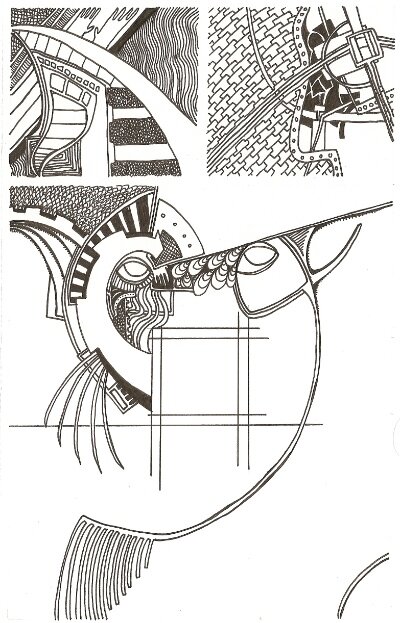 Einen reineren Fall von Aneinandervorbeireden (oder -schreien) könnte man kaum konstruieren. Es stellt sich heraus, dass die Einschätzungen auf zwei grundsätzlich verschiedenen Ebenen stattfinden, die wir „prozedural“ und „praktisch“ nennen wollen. Die prozedurale Einschätzung betrachtet die formalen Regeln, nach denen die Gruppe ausdrücklich ihre Entscheidungen regelt. Die praktische Einschätzung befasst sich mit der Praxis der Gruppe und den ihr zugrundeliegenden Angewohnheiten, Psychologien, Tradtionen und Zusammenhängen, die den Fortbestand dieser Praxis unterstützen. Auffällig an der Debatte zwischen Konsens und Mehrheitsrecht ist also, dass jede Seite die jeweils andere ausschließlich über ihre prozedurale Formulierung definiert, sich selbst aber hauptsächlich über die Formulierung ihrer Praxis.
Einen reineren Fall von Aneinandervorbeireden (oder -schreien) könnte man kaum konstruieren. Es stellt sich heraus, dass die Einschätzungen auf zwei grundsätzlich verschiedenen Ebenen stattfinden, die wir „prozedural“ und „praktisch“ nennen wollen. Die prozedurale Einschätzung betrachtet die formalen Regeln, nach denen die Gruppe ausdrücklich ihre Entscheidungen regelt. Die praktische Einschätzung befasst sich mit der Praxis der Gruppe und den ihr zugrundeliegenden Angewohnheiten, Psychologien, Tradtionen und Zusammenhängen, die den Fortbestand dieser Praxis unterstützen. Auffällig an der Debatte zwischen Konsens und Mehrheitsrecht ist also, dass jede Seite die jeweils andere ausschließlich über ihre prozedurale Formulierung definiert, sich selbst aber hauptsächlich über die Formulierung ihrer Praxis.
Die Umsetzung einer „direkten Demokratie“ nach Bookchin setzt voraus, dass erst nach einer vollständigen Diskussion abgestimmt wird. Direkte Demokratie ist per Definition eine Prozedur, angewandt durch eine „freie Gesellschaft, die Dissens nicht nur erlaubt, sondern in höchstem Maße fördert, deren Podien bei Versammlungen und deren Medien offen sind zum vollständigen Ausdruck aller Sichtweisen, deren Institutionen wirkliche Foren der Diskussion sind.“ Dass Bookchin dies als Selbstverständlichkeit ansieht, wird daran deutlich, dass er eine andere Verwendung der Wahl für das von ihm vorgeschlagene System gar nicht erst in Betracht zieht. Ähnlich definieren Verfechter des Konsensprozesses Konsens als ein Vorgehen, das von einer respektvollen Gemeinschaft zum ernsthaften Gespräch genutzt wird, von Gruppen, die als Forum für faire Diskussionen fungieren. Frage eine beliebige Verfechterin des Konsens, wie sie es befürworten kann, einem einzelnen, schwierigen Menschen die Möglichkeit zu geben jede Entscheidung zu blockieren, solange wir dessen Meinung nicht übernehmen – und sie wird dir antworten, dass so etwas überhaupt kein Konsensprozess ist.
In keinem Fall wird uns einfach abverlangt, die Möglichkeit des Missbrauchs der Prozeduren zu ignorieren. Konsensbefürworter beschreiben üblicherweise detailliert die Herangehensweisen, die notwendig sind, damit Teilnehmer in der Weise funktionieren, wie sie sollen. In manchen Fällen erklären sie die Arten von Disziplin, Training, Förderung und Übung, die zur Umsetzung benötigt werden. Bookchin schreibt ganz ähnlich über die Institutionen, die eine Gesellschaft braucht, und über die Herangehensweisen und die Arbeit, die Menschen in diese Institutionen hineintragen müssen, damit die Gesellschaft in echt demokratischen Foren auch gut funktioniert. Dies unterstreicht meinen Punkt: Die Praxis der Teilnehmer, ihre Fähigkeiten, Angewohnheiten, Beziehungen und Tugenden – gemeinsam mit den breiteren soziologischen Strukturen und Institutionen, die sie erzeugen und unterstützen – sind Dreh- und Angelpunkt.
§2 Zwei Fallstudien
In diesem Abschnitt schauen wir uns zwei Institutionen der Entscheidungsfindung an. Die eine ist eine sich selbst als radikal verstehende Organisation, die sich einer Ideologie der Partizipation und Vielfalt mit dem Ziel eines befreienden sozialen Wandels verschrieben hat und per Konsens entscheidet. Die zweite ist eine Mainstream-Institution – ein akademisches Institut – ohne Festlegung auf eine radikale Agenda, die offiziell nach einem formalen Wahlmechanismus vorgeht. Mein Punkt wird nicht die Behauptung sein, Wahlen führten zu besserem Verhalten als Konsens. Stattdessen will ich einige Aspekte der respektvollen Praxis unterstreichen, und darauf hinweisen, wie wenig doch formale Prozeduren mit der Qualität des menschlichen Miteinanderumgehens zu tun haben.
Der erste Fall betrifft die Mobilization for Global Justice (MGJ), den größten Zusammenschluss der Global Justice Movement, die aus dem Aufstand in Seattle 1999 entstand.9 Im Sommer und Herbst 2001 plante MGJ eine Kundgebung und Demonstration rund um das jährliche Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (WB) in Washington, D.C.. Ein breites Spektrum von Information, legalem Protest und zivilem Ungehorsam war geplant, in etwa so, wie solche Aktionen in den vorhergehenden Jahren durchgeführt wurden. MGJ war in Washington eine große, vielfältige und lebendige Gruppe, auch wenn sie, wie sich im Nachhinein herausstellte, zwei stark unterschiedliche Sorten Mitglieder hatte. Auf der einen Seite war ein breites Spektrum von Graswurzel-, Aktivisten-, oder Direkte-Aktion-Gruppen Teil der MGJ. Auf der anderen Seite nahmen einige formale Nichtregierungsorganisationen (NGOs) mit bezahlten Mitarbeitern teil.
 Die Angriffe auf Zivilisten in New York und Washington am 11. September 2001 führten zu einer Krise im progressiven Spektrum. Das war natürlich ein Vorfall, der die US-amerikanische Öffentlichkeit tiefgehend beeinflusste und fast alle verstanden, dass er den politischen Kontext in einer Weise änderte, die ein neues Nachdenken über Strategien und Taktiken erforderte. Bei einem Krisentreffen nach den Angriffen sprach sich nahezu jede Mitgliedsgruppe im MGJ für ein Zurückfahren der Konfrontation mit der Polizei aus, viele unterstützten den kompletten Verzicht auf Aktionen zivilen Ungehorsams, und eine Handvoll NGOs bevorzugte die vollständige Absage der Proteste.
Die Angriffe auf Zivilisten in New York und Washington am 11. September 2001 führten zu einer Krise im progressiven Spektrum. Das war natürlich ein Vorfall, der die US-amerikanische Öffentlichkeit tiefgehend beeinflusste und fast alle verstanden, dass er den politischen Kontext in einer Weise änderte, die ein neues Nachdenken über Strategien und Taktiken erforderte. Bei einem Krisentreffen nach den Angriffen sprach sich nahezu jede Mitgliedsgruppe im MGJ für ein Zurückfahren der Konfrontation mit der Polizei aus, viele unterstützten den kompletten Verzicht auf Aktionen zivilen Ungehorsams, und eine Handvoll NGOs bevorzugte die vollständige Absage der Proteste.
Repräsentanten dieser letzten Gruppe gelang es, am fraglichen Tag die Moderation der Sitzung zu stellen. Nach einer Weile der allgemeinen Diskussion wurde ein Vorschlag gemacht. „Die MGJ wird ihre Planungen für Proteste während des Treffens der Finanzinstitute fortführen“ (oder etwas sehr ähnliches). Sofort erklärten Repräsentanten der Gruppe, die die Proteste absagen wollten, ihre Blockade dieses Vorschlags. Einwänden, Argumenten, Diskussionen usw. wurde mit eisener Ablehnung begegnet. Der Vorschlag wurde blockiert und die Proteste abgesagt. Von Anwesenden wurde geschätzt, dass etwa 80 % der Teilnehmer gegen die Absage waren. Sie hatten aber keine Möglichkeit, sich durchzusetzen. Es gab keine wirkliche Diskussion oder Antworten auf die Argumente der Mehrheit, nur herablassende Vorträge darüber, wie man sich als verantwortungsvoller Protestierer zu verhalten habe, und eiserne Weigerung, die Blockade zu überdenken.10
Kontrastieren wir mit diesem Fall die Praxis einer ganz anderen Organisation, die in keiner Weise explizit radikal ist, sondern ein akademisches Institut: den Fakultätsrat der philosophischen Fakultät an der Georgetown University [eine römisch-katholische Jesuiten-Hochschule in Washington, D.C., A.d.Ü.]. In den vergangenen 15 Jahren war dieser Rat in seinen internen Diskussionen ein vorbildliches Beispiel für Höflichkeit, Vernunft und Respekt. Der Fakultätsrat ist mit etwa 24 Mitgliedern relativ groß. Er ist ideologisch, philosophisch und methodologisch ausgesprochen vielfältig, mit analytischen und kontinentalen Philosophen, Konservativen, Liberalen, Sozialisten, kapitalistischen Libertären, (einem) Anarchisten, gläubigen Katholiken und Atheisten.11 Dennoch respektieren sich die Mitglieder des Fakultätsrates in nahezu jedem Fall aufrichtig, und bei den wenigen anderen Fällen erkennen sie die Wichtigkeit, ihre Kollegen mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln. Diskussionen sind stets offen, intellektuell auf hohem Niveau und kreativ. Jeder beteiligt sich an ihnen. Repräsentanten der Masterstudenten ebenso wie andere Masterstudenten mit einer starken Meinung zum Thema nehmen voll und offen teil. Neue Mitglieder lernen schnell, dass man nicht versucht, Punkte zu sammeln, Kollegen niederzumachen, anderer Leute Argumente zu ignorieren, oder blind die Meinung eines anderen zu übernehmen. So laufen die Dinge an unserer Fakultät einfach nicht.
Prozedurell arbeitet die philosophische Fakultät in Georgetown mit einer Version der Mehrheitswahl, offiziell Roberts Regeln in der Diskussion folgend, mit Mehrheitsentscheid bei zwei Optionen und einer komplizierten Variante des Mehrheitsrechts bei mehr als zwei Möglichkeiten. In der Realität weiß niemand in der Fakultät besonders viel über Roberts Regeln und Abstimmungen sind üblicherweise eine unnötige Formalität. Im ersten Jahrzehnt meiner Teilnahme endeten nur eine Handvoll Abstimmungen nicht einstimmig, aus dem einfachen Grund, dass Diskussionen nahezu immer zu einer Position führten, die allen vernünftig erschien. Und in den wenigen Fällen, in denen jemand überstimmt wurde, geschah das meist mit überwältigender Mehrheit, wobei die Überstimmten den Mehrheitsentscheid vollständig akzeptierten.
Es ist klar, dass die Probleme bei der MGJ nicht vorrangig auf die Konsensprozedur zurückgeführt werden können. Hätte es Wahlen mit Mehrheitsentscheid gegeben, dann hätten die NGOs zum Beispiel eine Massenmobilisierung ihrer Mitglieder organisieren können. (Teil des Problems an jenem Tag war, dass alles in Eile stattfand, und dass diese Gruppen durch ihre bezahlten Mitarbeiter und besseren Kommunikationsnetzwerke sich wesentlich schneller auf das Treffen vorbereiten konnten.) Hätten sie das getan, und 51 % der Leute auf dem Treffen gestellt, dann hätten sie immer noch das Ergebnis auf ganz ähnliche Weise kontrollieren können. Auch wenn Bookchin (korrekterweise) darauf besteht, dass Mehrheitsrecht nicht die Tyrannei der Mehrheit, Befehle oder Anweisungen beinhalten muss, so ist doch klar, dass es diese Dinge beinhalten kann. Es gibt in den prozeduralen Regeln des Wählens sicher nichts, dass das verhindern würde. (Es sei daran erinnert, wie viele Staaten [der USA, A.d.Ü.] zur Zeit heterosexistische Gesetze erlassen. Obwohl diese üblicherweise vom Gesetzgeber kommen und nicht durch Volksentscheide herbeigeführt werden, gibt es wenig Zweifel daran, dass Volksentscheide in den meisten Fällen zum gleichen Ergebnis führen würden. Eine solche mehrheitliche Unterstützung macht diese Gesetze natürlich nicht weniger abstoßend, oder die Argumente dahinter weniger stumpfsinnig.)
Daher sind auch die bei der philosophischen Fakultät der GU angetroffenen Tugenden unabhängig von Wahlprozeduren zu sehen. Spätestens seit Platons Republik wurde festgestellt, dass es bei Mehrheitswahlen möglich ist, den Mob mit Bestechung, Rhetorik, Angst oder anderen irrationalen Mitteln dazu zu bringen der Minderheit Entscheidungen aufzuzwingen, die weder weise noch gerecht sind. Natürlich gibt es, wie Platon nicht müde wird zu betonen, keinen direkten Zusammenhang zwischen dem was die Mehrheit glaubt, und dem was richtig und gerecht ist. (Selbstverständlich gibt es auch keinen solchen Zusammenhang zwischen dem was alle glauben und dem was richtig und gerecht ist. Wenn wir uns alle einig sind, dann mag das auch nur daran liegen, dass wir unsere Ignoranz, Vorurteile oder Intoleranz teilen.)
§3 Warum die Konsensprozedur inhärent konservativ ist
Verteidiger der Konsensprozedur behaupten oft, der MGJ-Fall sei durch einen Bruch mit der Prozedur entstanden. Manche sagen, Konsensprozeduren enthielten eine Regel gegen das Wiedereröffnen von Fragen solange es dazu keinen Konsens gibt. Andere meinen, es gab ein Problem in der Formulierung des Vorschlags oder in der Struktur der Debatte. Das ist alles berechtigt, geht aber meines Erachtens am zentralen Punkt vorbei. Ich möchte behaupten, dass jede formale Prozedur missbraucht werden kann. In diesem Abschnitt aber konzentriere ich mich auf Konsens als Prozedur, und bringe ein recht abstraktes Argument dagegen vor.12
Obwohl Entscheidungsfindung durch Konsens typischerweise als radikale Alternative zu Wahlen dargestellt wird, oder zumindest als besser geeignet für radikale oder revolutionäre Projekte, stellt es sich heraus, dass die Konsensregeln schon allein strukturell sehr konservativ sind. Man erinnere sich, dass der Konsensprozedur zufolge ein Vorschlag formuliert wird und dann einstimmige Zustimmung – abgesehen von Enthaltungen – erhalten muss, um von der Gruppe angenommen zu werden. Das heißt, wenn eine Person dagegen ist, kann die Gruppe ihn nicht annehmen. Das erste Problem mit dieser Prozedur ist, dass sie ein Vorgehen nicht aufgrund des Inhalts oder der Bedeutung eines Vorschlags vorschreibt, sondern basierend auf den willkürlichen Eigenschaften seiner Formulierung. Man stelle sich beispielsweise vor, dass eine Gruppe mit einer Situation konfrontiert wird, in der sie normalerweise irgendeine Art von Protestaktion starten würde. Vielleicht handelt es sich um eine Kriegsgegnergruppe und die USA haben gerade eine Invasion begonnen. Nehmen wir um des Argumentes willen an, bis auf eine Person denken alle Mitglieder, dass ein Protest organisiert werden sollte, doch einer widerspricht energisch, aus was für Gründen auch immer. Hier sind zwei Möglichkeiten, wie die Meinungsverschiedenheit formuliert werden könnte.
Formulierung 1:
Gruppe A befürwortet, gegen die Invasion zu protestieren.
Gruppe B (eine Person) lehnt ab, gegen die Invasion zu protestieren.
Formulierung 2:
Gruppe B (eine Person) befürwortet, sich bezüglich der Invasion ruhig zu verhalten (nichts zu tun).
Gruppe A lehnt ab, sich bezüglich der Invasion ruhig zu verhalten.
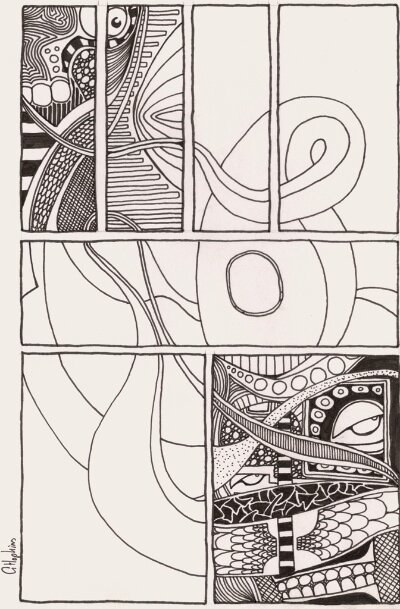 Der Unterschied zwischen beiden Formulierungen wird bei der Mehrheitswahl egal, beim Konsens ist er aber ausschlaggebend. Lautet der Vorschlag „lasst uns protestieren“, dann kann die Einzelperson blockieren und es passiert nichts. Wenn dagegen vorgeschlagen wird, nichts zu tun, so kann jeder der Befürworter von Protesten blockieren und damit einen Protest erzwingen.
Der Unterschied zwischen beiden Formulierungen wird bei der Mehrheitswahl egal, beim Konsens ist er aber ausschlaggebend. Lautet der Vorschlag „lasst uns protestieren“, dann kann die Einzelperson blockieren und es passiert nichts. Wenn dagegen vorgeschlagen wird, nichts zu tun, so kann jeder der Befürworter von Protesten blockieren und damit einen Protest erzwingen.
In einem Fall wie diesem würde man vermutlich annehmen, dass Formulierung 1 die richtige ist. Wofür wir Konsens brauchen, ist, um etwas zu tun, und wenn wir keinen Konsens erreichen können über das was zu tun ist, wird die Gruppe nichts tun. Doch selbst wenn diese Unterscheidung in Handeln und Nichthandeln immer Sinn ergeben würde, so sollten radikale Gruppen ihr doch nicht eine solche Bedeutung beimessen. Ist nicht ein Kernpunkt unserer Analyse, dass Nichthandeln eine Form des Handelns ist? Wenn jemand seinem eigenen Leben nachgeht und politische, ökonomische und kulturelle Auseinandersetzungen ignoriert, argumentieren wir dann nicht stets, dass er dadurch den status quo unterstützt und eine konkrete Rolle dabei spielt, das System am Leben zu erhalten? Sich zurückzulehnen, mag in bestimmten Situationen richtig sein, aber wir Radikale bestehen immer darauf, dass man dadurch trotzdem etwas tut, etwas, das genauso der Rechtfertigung bedarf wie alles andere.
Wie seltsam ist es also, einen Entscheidungsfindungsprozess zu verteidigen, der grundsätzlich Nichthandeln dem Handeln vorzieht, denn genau das macht die Konsensprozedur, so wie sie derzeit verstanden wird. Wenn wir darauf bestehen, dass die Formulierung eines Vorschlags positiv sein muss – ein Vorschlag, etwas zu tun statt etwas zu unterlassen –, dann erlauben wir einer einzelnen stark vertretenen Meinung, Handeln zu verhindern, während die ebenso stark vertretene Meinung aller anderen nicht ausreicht, Handeln herbeizuführen. Darum ist, wenn die vorige Argumentation über die Rolle des Handelns in einem intitutionalisierten Umfeld richtig ist, der Konsensprozess sehr konservativ und privilegiert eine Unterstützung des status quo viel stärker als es Wahlen tun.
Es sollte offensichtlich sein, dass die meisten Formen von sogenanntem „modifiziertem Konsens“ nicht besser motiviert sind. Eine Dreiviertel- oder Zweidrittel-Mehrheit für eine positive Entscheidung zu benötigen privilegiert immer noch Untätigkeit vor Handeln. Solange man das nicht zu Ende denkt bis zu einem Prinzip wie „versucht, einen Konsens zu finden, und wenn das fehlschlägt, dann wählt“, bleibt man in einer Prozedur stecken, die asymmetrisch ist zwischen Handeln und Nichthandeln. Und ich sehe keinen Grund, warum man eine solche Asymmetrie akzeptieren sollte.
Ich sollte betonen, dass es mir hier nicht darum geht, die Unterscheidung zwischen Blockade und Tolerierung in der Konsensprozedur zu kritisieren. Das ist sicherlich eine nützliche Unterscheidung. (Man könnte aber noch weitergehen. Offensichtlich fällt unsere Ablehnung verschiedener Vorschläge nicht immer glatt in eine von zwei Kategorien. Es gibt ein Intervall, sogar einen mehrdimensionalen Raum, von Einstellungen, die man einem gegebenen Vorschlag gegenüber annehmen kann. Unterstützen/tolerieren/blockieren ist ausgefeilter als unterstützen/ablehnen, aber nur mit einem Faktor von 3:2.) Was ich ablehne ist eine Prozedur, die nicht symmetrisch zwischen Unterstützung und Ablehnung des fraglichen Vorschlags ist.
Nehmen wir an, eine Palästina-Solidaritätsgruppe erwägt, in einer Stellungnahme das Recht auf Rückkehr [der vertriebenen Palästinenser in ihre ursprünglichen Siedlungsgebiete, A.d.Ü.] zu fordern. Sagen wir, dass einige Personen sich deutlich gegen eine solche Stellungnahme wenden, aber die Ziele und Praktiken der Gruppe in anderer Weise unterstützen, während andere sich dem Inhalt einer solchen Stellungnahme tief verpflichtet fühlen, da sie ein Schweigen zu dem Thema als Beleidigung der Mehrheit der Palästinenser, die als Flüchtlinge leben, empfänden. Warum sollte die eine Überzeugung schon allein durch die Regeln der Abstimmung wichtiger gemacht werden als die andere? In jedem Fall könnte jemand tiefe moralische Ablehnung oder Unterstützung empfinden, die er für essentiell für das Wohlergehen der Gruppe hält. Wie auch immer wir das lösen, ob wir uns nun für
Formulierung 1: Wir drücken unsere Unterstützung des Rechts auf Rückkehr aus
oder
Formulierung 2: Wir nehmen keine Stellung zum Recht auf Rückkehr
entscheiden, und damit der einen oder der anderen Gruppe Vetomacht über die andere geben, das ist sicherlich kein vernünftiger Lösungsweg.
Wie solch eine schwierige Auseinandersetzung ausgeht – ausführliche Debatte, kreative Kompromisse, oder gar Gruppenauflösung – sollte nicht abstrakt geregelt werden, am wenigsten durch in Stein gemeißelte Gruppenregeln. Es ist schlicht unmöglich, dass hier eine Prozedur, die eine tiefe Überzeugung einer anderen vorzieht, helfen kann. Wir müssen argumentieren. Und wenn Argumente fehlschlagen, dann muss eine Gruppe ihre strikte Haltung aufgeben. Wie könnte man sonst einen klugen Beschluss fassen, wenn nicht durch sachbezogene Argumenten rund um das Recht auf Rückkehr, seine politische Bedeutung, die taktische Frage, ob man es unterstützt oder schweigt, usw.. Doch genau das behaupten Konsensregeln leisten zu können – solche Konflikte formal beilegen zu können, bevor die Probleme im Kern diskutiert wurden.
§4 Tugendhafte Praxis und die Notwendigkeit einer Prozedur
Ich kann mir das Gegenargument eines Befürworters des Konsenses zum vorigen Argument gut vorstellen. „Sicher,“ könnte er zustimmen, „es gibt etwas inhärent Konservatives daran, Einzelpersonen Vetomacht über Aktionen zu gestatten. Doch das ist keine angemessene Art, den Konsensprozess zu charakterisieren. Konsens setzt voraus, dass wir die Möglichkeit der Blockade nicht als Vetomacht missbrauchen, die uns immer zur Verfügung steht, wenn wir mit der Richtung, die die Gruppe einschlägt, nicht einverstanden sind. Die Konsensprozedur kann nicht von der Konsenspraxis losgelöst betrachtet und bewertet werden. Wenn wir sie uns gemeinsam ansehen, so sehen wir, dass Blockaden nur verwendet werden, wenn man ernste Vorbehalte der fraglichen Aktion gegenüber hat, Vorbehalte, die einem so wichtig erscheinen, dass man die Gruppe durch seine Intervention vom Handeln abhält.“
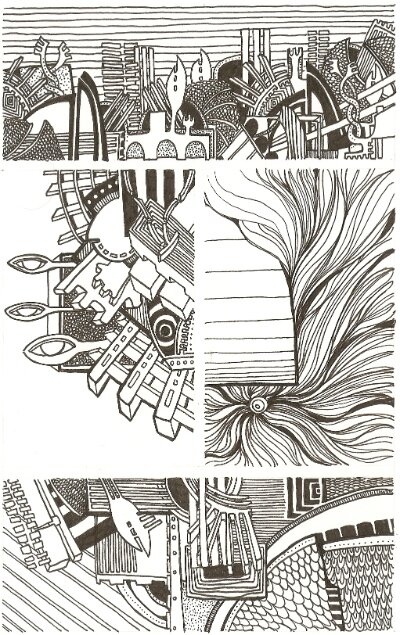 Eine solche Antwort geht jedoch aus zwei Gründen am eigentlichen Punkt vorbei. Erstens gibt es weiterhin keine Rechtfertigung für die prozedurelle Asymmetrie zwischen Handeln und Nichthandeln. Warum gibt man nicht gleich jedem die Möglichkeit, Nichthandeln zu blockieren? Warum sollte es mir, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Nichtantworten auf eine Erklärung des Kongresses das Recht auf Rückkehr abzulehnen, moralisch absolut nicht zu rechtfertigen und sogar mit der Idee einer Solidaritätsorganisation unvereinbar ist, dann nicht möglich sein, unser Nichtstun zu blockieren? Zu sagen, ich dürfte das grundsätzlich nicht, wohingegen andere grundsätzlich jedes Handeln gegen diesen rassistischen Beschluss blockieren können, ist struktureller Konservatismus, ganz egal, was in der Praxis noch berücksichtigt wird.
Eine solche Antwort geht jedoch aus zwei Gründen am eigentlichen Punkt vorbei. Erstens gibt es weiterhin keine Rechtfertigung für die prozedurelle Asymmetrie zwischen Handeln und Nichthandeln. Warum gibt man nicht gleich jedem die Möglichkeit, Nichthandeln zu blockieren? Warum sollte es mir, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Nichtantworten auf eine Erklärung des Kongresses das Recht auf Rückkehr abzulehnen, moralisch absolut nicht zu rechtfertigen und sogar mit der Idee einer Solidaritätsorganisation unvereinbar ist, dann nicht möglich sein, unser Nichtstun zu blockieren? Zu sagen, ich dürfte das grundsätzlich nicht, wohingegen andere grundsätzlich jedes Handeln gegen diesen rassistischen Beschluss blockieren können, ist struktureller Konservatismus, ganz egal, was in der Praxis noch berücksichtigt wird.
Das zweite Problem ist, dass der Verweis auf eine gute Praxis zur Verteidigung einer gegebenen Prozedur den Sinn einer Prozedur verfehlt. Ich habe bereits zuvor angemerkt, dass die Beispiele für Praxen, die erfahrene Verteidiger von Konsens und Wahlen nennen, bemerkenswert ähnlich sind. Alle betonen die Notwendigkeit, die Positionen aller einzubeziehen, vorsichtige und kritische Vernunft walten zu lassen, neuen Ideen gegenüber offen zu sein, Kreativität in der Formulierung von Alternativen zu erlauben, die Wichtigkeit des Erreichens von Einigungen anzuerkennen, usw.. Kurz, es werden in diesen Diskussionen die Tugenden betont, die ein demokratischer Bürger haben muss, und die institutionellen Strukturen, die dem Training neuer Mitbürger dienen, damit diese solche Tugenden verkörpern und aufrechterhalten können.
Obwohl ich in diesem Artikel zur Diskussion der demokratischen Praxis nichts Inhaltliches hinzuzufügen habe13, geht es mir sicherlich nicht darum, diesen Schwerpunkt zu kritisieren. Wie auch immer die tugendhafte Praxis konkret aussehen mag – noch einmal, im Rahmen dieses Artikels nehme ich eine solche Idee als gegeben an –, mein Hauptpunkt ist, dass das Verständnis, die Umsetzung und die Aufrechterhaltung einer solchen Praxis für demokratische Gesellschaften zentral ist. Im Moment will ich jedoch die einfachere Frage stellen, welche Rolle die Prozedur eigentlich spielt, wenn Menschen und Gruppen vernünftige, moralische und politische Tugenden vollständig verkörpern. Wir haben bereits argumentiert, dass weder Wahl- noch Konsensprozedur helfen können, wenn diese Tugenden fehlen. Wenn ein signifikanter Prozentsatz der Gruppe Prozeduren missbrauchen will, dann wird jedwede Prozedur missbraucht.
Was aber, wenn wir uns in der gegenteiligen Situation befinden: Alle sind tugendhaft – respektvoll zueinander, trotzdem entschlossen für ihre Wahrheit zu argumentieren, sorgfältig und kritisch zuhörend, wohlinformiert und Informationen mitteilend, interessiert am Wohlergehen der Gruppe, ihrer Mitglieder und der Gesellschaft insgesamt, usw.? Nun, in einer solchen Situation wird nahezu jede Prozedur ihren Zweck erfüllen. Es könnte die „lasst Lelia entscheiden“-Prozedur sein, denn Lelia, die tugendhaft ist, wird keine Entscheidung treffen, ohne eine offene und umfassende Diskussion mit ihren Genossen durchzuführen. Sie wird an der Diskussion teilnehmen – nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus dem Bedürfnis heraus, die Wahrheit zu entdecken – und am Ende der Diskussion, wenn sich die beste Position herausstellt – soweit wir in diesem Zusammenhang mit dieser Information und unseren intellektuellen Fertigkeiten dazu fähig sind –, wird sie diese wählen, genauso wie es jeder andere in unserer perfekten Gemeinschaft getan hätte. Dasselbe Resultat hätten wir auch bei Wahlen, Konsens, usw. gehabt.
Wenn also Prozeduren völlig unnötig sind für gänzlich tugendhafte Gruppen, und hilflos angesichts hochgradig boshafter Gruppen, wann sind sie denn sinnvoll? Selbstverständlich für solche Gruppen, die sich irgendwo dazwischen befinden. Wir greifen zu Recht genau dann auf Prozeduren zurück, wenn eine Gruppe die generell respektvoll und nicht manipulativ ist, in lokal begrenzte Schwierigkeiten gerät. Vielleicht fühlt sich die eine oder andere Person ein wenig eingeschüchtert und nimmt nicht teil. Vielleicht macht jemand seine Hausaufgaben nicht, bevor er sich an einer Diskussion beteiligt.
In einem Fall wie diesen gibt es einen Punkt, an dem die Gruppe beginnen sollte, irgendeine Art von halbwegs gut definierter Prozedur zu befolgen um mit dem Problem umzugehen – im Raum herumgehen und jeden um Wortmeldung bitten bevor andere sprechen, akzeptieren, dass Vorankommen wichtig ist und sich auf eine Wahl einigen, eine Liste der Dinge machen, über die Leute sich vor dem nächsten Treffen informiert haben sollten. Zwei Dinge sind jedenfalls klar. Erstens, während begründete Debatte, respektvolle Diskussion und andere Aspekte der Praxis intrinsisch wertvoll für den Prozess sind, ist die Prozedur rein instrumentell. Wir verwenden Prozeduren als pragmatisches Werkzeug, um ein konkretes Problem im Laufe unserer Diskussion zu überwinden.
Wir sollten nicht nur Prozeduren instrumentell und pragmatisch sehen, sondern auch einen zweiten Punkt anerkennen: dass die Nützlichkeit jeder Prozedur stark vom Kontext abhängt. Da in einer Gruppe auf vielerlei Arten etwas schiefgehen kann, gibt es keinen Grund anzunehmen, wir könnten eine Allzweckprozedur finden, auf die wir stets zurückgreifen können – „wir versuchen zu diskutieren, aber wenn das fehlschlägt, dann wählen wir“, doch warum? Vielleicht benötigen wir eher eine Gesprächsrunde, in der jeder versucht, einen zuvor nicht genannten Lösungsvorschlag zu nennen, oder wir gehen alle heim und kühlen unsere Gemüter, oder wir holen einen Vermittler dazu, oder wir lesen ein relevantes Buch, oder einige von uns entscheiden sich, eine Position zu tolerieren, oder wir teilen uns in zwei Gruppen auf, oder vereinigen uns mit einer größeren, usw.. Jede dieser Varianten könnte ein sinnvolles Vorgehen als Reaktion auf eine bestimmte Art von Problem sein.
Was wir also brauchen, ist keine Prozedur, und erst recht nicht die Gleichsetzung eines guten Prozesses mit einer Prozedur, sondern einen gut ausgestatteten Werkzeugkasten von Techniken, mit deren Hilfe wir mit den Schwierigkeiten fertigwerden, die in grundsätzlich gut funktionierenden aber fehlbaren Gruppen auftreten. Noch dringender brauchen wir gut ausgebildete Handwerker, die mit diesen Werkzeugen umgehen können. So wie manche fähig sind bei der Wahrnehmung psychologischer Symptome, andere im Entwurf experimenteller Pläne und wieder andere in der Entwicklung komplexer politischer Strategien, so gibt es auch jene, die sich wertvolle Fähigkeiten bei der Anwendung von Prozedurwerkzeugen zur Behebung von Störungen im gemeinschaftlichen Diskurs erworben haben. Diese Menschen nennen wir Vermittler, Mediatoren oder Trainer. Und wir sollten sie nutzen. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir ihnen mehr vertrauen sollten – blind ihrer Empfehlung zum Prozess folgend – als auf formale Prozeduren. Wenn es aber einer Gruppe erscheint, dass jemand ein nützlicher Vermittler ist – das heißt, uns durch Anleitung in der Anwendung eines breiten Spektrums von nützlichen Prozeduren helfen kann –, sollten wir Nutzen daraus ziehen.
§5 Praktische Empfehlungen für kontextabhängige Prozeduren
Wenn die Gruppe zur Ansicht gelangt, am wichtigsten sei eine Entscheidung, auch wenn die Diskussion sich nicht in Richtung eines Konsenses bewegt, dann ist ein Ausweg, Konsens über die Angemessenheit von Wahlen zu erreichen. Solch eine Entscheidung sollte immer als Eingeständnis eines gewissen Scheiterns angesehen werden. Vorausgesetzt, dass die Frage nicht belanglos ist, dann ist eine der Alternativen in der Realität wirklich die bessere. Die Tatsache, dass wir keine Erkenntnisse, Erwägungen, Argumente, Daten und ähnliches finden können, die die eine oder andere Alternative unterstützen, ist daher ein Zeichen dafür, dass wir schlecht argumentieren, etwas übersehen, nicht ausreichend Daten haben oder dass manche von uns sich nicht rational verhalten. Dennoch passiert soetwas im Gedränge des Alltags, und dann entscheiden wir machmal schlicht und einfach zu wählen.
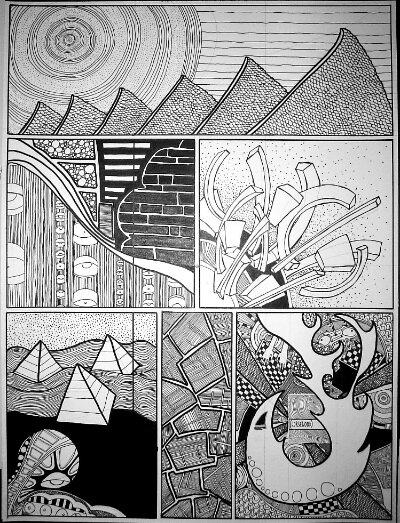 Wenn wir uns so entscheiden, dann folgt aus unserem Argument aus Abschnitt 2, dass unsere Prozedur symmetrisch sein sollte. Darum wird die Prozedur, auch wenn sie nicht so simpel wie ein Mehrheitsentscheid sein muss, unter solchen Umständen eher einer Wahl- als einer Konsensprozedur ähneln. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass es nichtsdestotrotz irreführend wäre, sich dies als Bevorzugung von Wahl über Konsens vorzustellen.
Wenn wir uns so entscheiden, dann folgt aus unserem Argument aus Abschnitt 2, dass unsere Prozedur symmetrisch sein sollte. Darum wird die Prozedur, auch wenn sie nicht so simpel wie ein Mehrheitsentscheid sein muss, unter solchen Umständen eher einer Wahl- als einer Konsensprozedur ähneln. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass es nichtsdestotrotz irreführend wäre, sich dies als Bevorzugung von Wahl über Konsens vorzustellen.
Zur Veranschaulichung möchte ich von einer bestimmten Entscheidung erzählen, die vom philosophischen Fakultätsrat der Georgetown University getroffen wurde. An jenem Tag hatten wir eine hochumstrittene Entscheidung zu treffen, zu der es keinen möglichen Kompromiss gab. Das heißt, diese Entscheidung war von der Art, bei der es genau zwei Möglichkeiten gibt. Und die Fakultät erschien tief gespalten zum Treffen. Gruppe A empfand das Annehmen des uns vorliegenden Vorschlags als richtig und wichtig für die Zukunft der Fakultät. Gruppe B fand die Ablehnung derselben Entscheidung ebenso wichtig. Und so diskutierten wir die Sache. Wir argumentierten hin und her, brachten neue Einsichten vor, legten Wege über das Thema nachzudenken dar, versuchten die Entscheidung kreativ mit bereits getroffenen Entscheidungen zu vergleichen, das Thema im größeren Kontext der Ziele der Fakultät zu beleuchten, usw. …etliche Stunden lang. Nur wenige wechselten ihre Meinung. Da wir merkten, dass wir wenig Fortschritt machten, rief schließlich der Vorsitz zur Wahl auf. Und der Vorschlag wurde beschlossen, mit soetwas wie 16 zu 8 Stimmen, woraufhin wir uns zum Gehen aufmachten, in der Annahme, der Vorsitz würde dem Dekan diese Entscheidung mitteilen.
Bevor es jedoch dazu kam, hielt uns die Wortführerin der Gruppe A – der erfolgreichen Gruppe – auf. „Wartet,“ sagte sie14, „ich habe noch nie erlebt, dass wir eine so wichtige Entscheidung mit einer solchen Spaltung beschlossen haben. Es mag nicht unsere Regel sein, aber es ist unsere Praxis, Dinge so lange zu diskutieren bis wir zu einem Ergebnis gelangen, das wir alle respektieren. Und wir nehmen die Bedenken aller stets ernst. Ich befürchte, dass sich die Minderheit hier überrumpelt fühlen wird, darum denke ich, dass wir weiter diskutieren sollten.“ Obwohl niemand begeistert war, länger bleiben zu müssen, hörten sogleich alle den Ruf und kehrten auf ihre Stühle zurück.
Daraufhin sagte der Wortführer der unterlegenen Gruppe: „Ganz sicher nicht. Wir haben unsere Argumente vorgebracht, unsere Gründe genannt. Wie immer haben alle zugehört und uns ernstgenommen. Wir haben euch nicht überzeugen können. Darum will ich von einem Wiederöffnen des Themas nichts hören. Wir haben einen Fall, in dem wir uneins sind und eine starke Mehrheit der Fakultät einer Meinung ist. Das einzig Vernünftige, das wir alle in einem solchen Fall unterstützen können, ist das vorhandene Wahlergebnis.“
Was ist hier geschehen: Mehrheitswahl oder Konsens? Es ist offenbar irreführend, die Vorgänge so oder so zu charakterisieren. Wir fanden keinen Konsens in der vorliegenden Frage, aber ebenso wenig wählten wir einfach. Vielmehr einigten wir uns darauf, die Mehrheitsposition zu beschließen. Wir erkannten, dass unsere kollektive Vernunft, unsere Gruppentugend, nicht ausreichend war, um zu einem Konsens zu gelangen, und bedienten uns darum einer formalen Wahlprozedur. Doch unser lokaler Fehlschlag ließ eine tieferliegende strukturelle Tugend zum Vorschein kommen – sowohl auf Seiten jedes Einzelnen als auch kollektiv in unserer Diskussionskultur. Und es ist genau diese Art von Tugend, die bei der Mobilization for Global Justice fehlte. Statt eine respektvolle und sorgfältige Diskussion fortzuführen, bis wir zu einem Konsens gelangten, wenn schon nicht darüber was zu tun sei, so doch zumindest darüber welche Prozedur wir anwenden wollten, setzte eine kleine Minderheit die mechanische Durchführung einer speziellen Prozedur gegen den Willen der Mehrheit durch, da diese Prozedur bereits im Vorfeld festgelegt worden war. Bei einer solchen sozialen Verfehlung war es kein Trost, dass die Prozedur einen so fröhlichen Namen wie „Konsens“ trug.
§6 Streitbare Schlussbemerkungen
Wo stehen wir also? Obwohl ich kaum detailliert genug argumentiert habe für solch große Behauptungen, möchte ich doch eine Reihe von Schlussfolgerungen aus der vorangehenden Diskussion festhalten:
Ein Schlüsselziel jeglicher anarchistischen Strategie muss die Entwicklung einer diskursiven, sozialen und rationalen Tugend in uns allen sein.
Jede ernstzunehmende anarchistische Gesellschaft muss Dinge wie Schulen, Diskussionsforen und kritische Diskussionen etablieren, die es uns erlauben werden, solche Tugenden in uns selbst heranzubilden und zu erhalten.
Der einzige vollkommen demokratische Weg der Entscheidungsfindung ist die Diskussion, an deren Ende ein Konsens über die richtige Entscheidung steht.
Verhindert unser lokaler Mangel an Tugend eine vollkommen demokratische Praxis der Entscheidungsfindung in einem bestimmten Fall, dann gibt es beliebig viele Prozedurregeln (und Menschen, die sie gekonnt anwenden können), auf die wir zurückgreifen können, um mit dem Problem umzugehen.
Stellen wir fest, dass wir eine Entscheidung fällen müssen, aber keinen Konsens über die richtige Entscheidung erreichen können, so sollten wir so gut wie irgend möglich Handeln und Nichthandeln symmetrisch behandeln. Es gibt keinen Grund, das eine oder das andere abstrakt zu privilegieren. (Aber natürlich könnten wir uns darauf einigen, dass im konkreten Fall entweder Zurückhaltung oder Handeln aus bestimmten Gründen vorzuziehen ist.)
Können wir keinen Konsens zu einem gegebenen Thema erreichen, dann wird die Frage, wie wir zu einer Entscheidung kommen, zum Thema, und hierfür wird Konsens benötigt. Obwohl wir vermutlich wählen werden, kann eine solche Prozedur nur gerecht sein auf der Basis eines vernünftig und moralisch erreichten Konsenses über die Angemessenheit des Wählens in diesem Fall. Wahlen sind häufig die richtige Prozedur, und sie werden mit größerer Wahrscheinlichkeit prozedurell korrekt ablaufen als eine Konsensprozedur. Doch die gesamte Anerkennung der Wahlprozedur wird von der Konsenspraxis abhängen.
Dies alles scheint auf eine bestimmte, recht praktische Empfehlung an alle, die eine anarchistische Organisation aufbauen wollen, hinauszulaufen: Schreibt keine Prozeduren als Teil der definierenden Strukturen eurer Gruppe nieder! Jegliche Prozedur, die ihr festzuschreiben versucht, kann gleichermaßen missbraucht werden, als Krücke zum Anlehnen missverstanden werden oder als Vorwand, gründliches Nachdenken, Diskutieren und integrierende Arbeit zu vermeiden. Keine Prozedur garantiert, dass weise Entscheidungen getroffen werden, aber eine große Vielfalt an Prozeduren kann nützlich sein, um zu weisen Entscheidungen zu gelangen. Privilegiert also nicht schon abstrakt die eine vor der anderen. Wenn ihr unbedingt eine Verfassung haben wollt, dann schreibt Dinge wie: „Unsere Gruppe wird versuchen, sich gegenseitig ernst zu nehmen, Themen vernünftig zu besprechen, Analysen und Argumente sorgfältig, respektvoll, kritisch und rigoros anzugehen, und zur weisesten und gerechtesten Entscheidung bei allen uns erwartenden Themen zu kommen.“ Wenn ihr mehr als dies sagen müsst, dann sagt viel mehr. Sagt, dass unter den Werkzeugen, die ihr verwenden werdet um zu solchen weisen und gerechten Entscheidungen zu gelangen, folgende gehören:… und dann beginnt eine immer weiter wachsende Liste nützlicher Techniken.
Vor allem: Erinnert euch, dass Verfassungen und ihre Regeln nie besser sind als die Menschen, die sie umsetzen. Unsere Aufgabe ist ebenso sehr, bessere Versionen von uns selbst zu machen, wie bessere Versionen der Gesellschaft.
Anmerkung der Übersetzerin: Obiger Text ist eine für Systempunkte angefertigte Übersetzung des Essays „Fetishizing Process“ von Mark Lance aus dem Jahre 2005, nachzulesen zum Beispiel hier: http://anarchistnews.org/?q=node/231
Illustrationen: "Intercorstal", von Gareth A. Hopkins
- 1. aus „Coming to Consensus: Tips for Cooperation and Collaboration in Decision Making, or How to Run Meetings So Everyone Wins“ von Mark Shepard
- 2. aus dem Kapitel „Group Process“ von Sanderson Becks „Nonviolent Action Handbook“
- 3. Randy Schutt: „Notes on Consensus Decision Making“
- 4. a. b. Murray Bookchin: „What is Communalism? The Democratic Dimension of Anarchism“
- 5. Janet Biehl: „On Consensus“
- 6. Ich habe dieses Beispiel nicht selbst überprüft, darum vertraue ich um des Argumentes willen auf Bookchins Wort. Von den tatsächlichen Verhältnissen dort hängt hier nichts wichtiges ab.
- 7. Löwen und Tiger und Bären, oweh!
- 8. C.T Lawrence Butler: „A Revolutionary Decision-Making Process“
- 9. Der folgende Bericht entspringt persönlicher Erfahrung. Ich war zentral beteiligt am Planungsprozess der MGJ für die Kundgebung. Obwohl ich mich hauptsächlich mit der Informationsreihe während der Proteste beschäftigte – dem Volks-Gipfeltreffen –, nahm ich auch an allgemeinen MGJ-Treffen teil. Viele andere haben meine Erinnerung an diese Ereignisse bestätigt, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass es auch anderslautende Aussagen gibt. Das allgemeine Argument, das ich hier anbringen möchte, hängt davon jedenfalls nicht ab. Man könnte genausogut dieses als hypothetisches Beispiel verstehen für eine Art, wie Konsensprozeduren missbraucht werden können. Mir scheint es aber auch wichtig zu sein, den realen Schaden, der durch solchen Missbrauch für die Zusammenhänge, in denen wir uns engagieren, entsteht, anzuerkennen. Darüber hinaus ist es wichtig, Vorgehensweisen zu entwickeln, solchen Versuchen unsere Praxis zu missbrauchen entgegenzuwirken. Die Verwendung dieses realen Beispiels statt eines hypothetischen verstehe ich als kleinen Schritt auf dem Weg zu solchen Vorgehensweisen.
- 10. Die Folgen dieser beschämenden Manipulation waren immens. Das Vakuum, das durch den Rückzug der MGJ entstand, wurde vorhersehbarerweise von ANSWER [einer Organisation, die enge Verbindungen zur marxistisch-leninistischen Workers World Party (WWP) unterhält, A.d.Ü.] gefüllt, ein bedeutender Vorgang für den (glücklicherweise nur temporären) Aufstieg dieser autoritären Organisation. So tief verletzt und betrogen fühlten sich viele durch die Vorgänge jenen Tages und der folgenden „Verteidigungen“ dieses Vorgehens – Verteidigungen, die häufig persönliche Angriffe und Beleidigungen beinhalteten –, dass die MGJ sich faktisch auflöste. Nahezu alle Graswurzelaktivisten verließen MGJ und traten anderen Bündnissen bei, in der Regel mit weit weniger Ressourcen. Die meisten NGOs verblieben, doch ihre weiteren Protestaktionen und Informationsveranstaltungen waren nur ein Schatten ihrer vorigen Stärke. Es ist bemerkenswert, dass einer der Anführer des Putsches im September die Absage der Veranstaltungen wiederholt mit der Behauptung verteidigte – viermal habe ich dies bei verschiedenen Foren in den nächsten zwei Jahren gehört –, es habe einen Konsensbeschluss für die Absage gegeben. Eine solche Verwendung von Sprache kann man kaum anders nennen als Orwell'sches Neusprech.
- 11. Ich sollte wohl erwähnen, dass ich mit Sicherheit nichts über Hochschulen und ihre Institutionen insgesamt aussagen möchte. Die wenigsten funktionieren so wie unsere Fakultät. Viele sind irrationale, gehässige, dogmatische und unterdrückende Institutionen.
- 12. Obwohl der Einwand den dieser Abschnitt beinhaltet wirklich ganz offensichtlich ist, wurde er meines Wissens noch nirgendwo anders diskutiert. Da dieser Punkt so naheliegend ist, würde es mich jedenfalls nicht wundern, wenn er an anderer, mir unbekannter Stelle bereits geäußert wurde.
- 13. Sowohl zu den zugrundeliegenden philosophischen Ideen als auch zu den spezifischen Praktiken habe ich noch einiges hinzuzufügen. Das wird in meinem Buch „Awakening Reason: towards a constructive anarchism“ geschehen.
- 14. Ungefähr. Dies ist kein exaktes Zitat, fasst aber zusammen, was gesagt wurde.


Kommentare
Das Problem liegt nicht für oder gegen Mehrheitsentscheid oder Konzernabschlusses - es muss überschreiten werden – weil die Anarchie das Problem transchiert und eine zur einer Frage der materielle und sozialen Verhältnisse macht. Warum kann man keinen gemeinsamen Nenner finde in einer Gesellschaft des künstlichen mangels mitten im Überfluss. Egal Weilchen Prozess man bevorzugt sag das sehr wenig aus über de geschäftlichen Verhältnisse aus und über die Ideologien die de Leute haben. Demokratie beinhaltet eine Ideologie der Einheit/Identität (Demo) und eine Ideologie des Prozessen/Trennung (-kratie) oder. Die Frage ist ob wir als Anarchist eine Praktik schaffen die neu Relationen bringen die sich kritisch gegen über diesen Seiten der Demokratie stellen und neues formen und Fora schaffen wo de mehr als ideale Demokratie (Direkte Demokratie) ist und den Übergang von Volksherrschaft zur keinen herschafft Schaft. Sprachlich, ideologisch und pragtisch müssen der Anarchismus einige Paradigmen umstürzen und die Masse der einzelnen Interesses anmerkenden und diese praktisch umsetzen in Gemeinschaften die auf freie Vereinbarung aufbauen – Ich würde von einer: „post-Demokratie“ aus rein philosophischer Sicht sprechen.
In der jetzigen Gesellschaft ist es immer einen Frage der herschafft welchen Prozess man bevorzugt, und in anarchistischen Organisationen kann man dies nur bedingt aufheben, man muss sich fragen wie kann man herschafft unnötig machen so gut es geht jetzt und in der fernen Zukunft. Ich bevorzuge Konsensus weil es der Minderheit Garantien sichert die es ganz grundsätzlich nicht in der Mehrheitsdemokratie gibt, aber aus meiner Erfahrung heraus kann Konsensus genau so problematisch sein wenn es nicht einen Minimum an gemeinsamen Nenner gibt und sich Minderheiten oder Mehrheiten einfach querstellen und Beschlüssen verhindere. Das Konsensverfahren können direkt konservativ und reaktionär, aber meinen Erfahrungen in Christiana und Ungdomshuset sagt mir aber auch wenn man genug Autonomie hat kann dieser Konsensus jederzeit praktisch untergraben werden und neu Möglichkeiten schaffen um neu Beschlüsse zu erreichen.